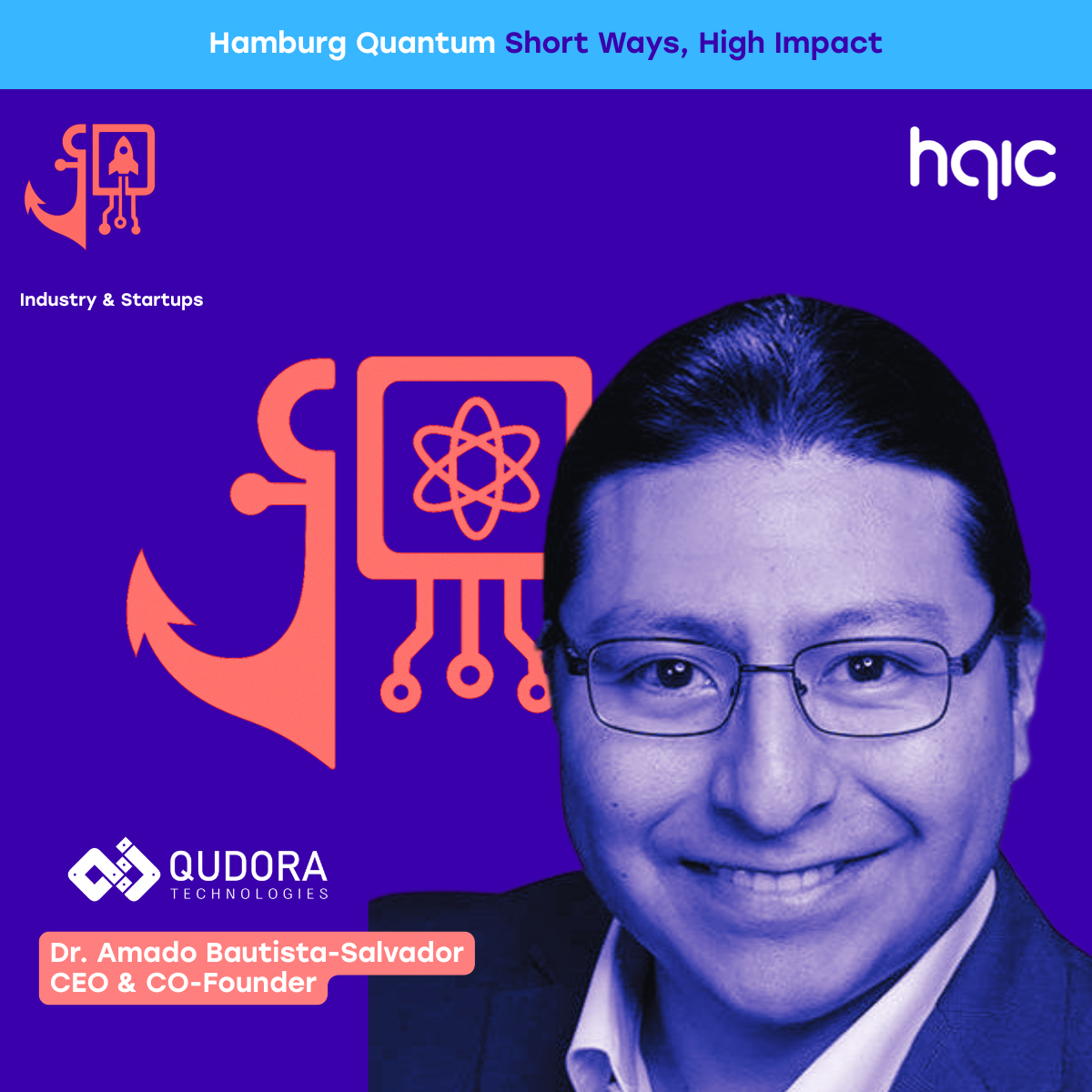Ihr setzt voll auf Ionenfallen als Plattform für Quantencomputer. Was sind aus deiner Sicht die größten technologischen Vorteile dieses Ansatzes – gerade im Vergleich zu anderen wie supraleitenden Qubits?
„Der größte Vorteil von Ionenfallen liegt in der Qualität der Qubits. In Qudora arbeiten wir mit einzelnen geladenen Atomen, die identisch sind und sich äußerst präzise kontrollieren lassen. Das bedeutet: sehr hohe Kohärenzzeiten, extrem niedrige Fehlerraten und ein skalierbares Architekturkonzept. Im Gegensatz zu supraleitenden Qubits, die stark vom Material und vom Fertigungsprozess abhängen, sind Ionenfallen deutlich weniger anfällig für Rauschen und benötigen kein tiefes Kryosystem. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die All-to-All-Konnektivität: Alle Qubits können direkt miteinander interagieren, was viele Algorithmen effizienter macht. Zudem lassen sich Qubits flexibel auch über Distanz koppeln – ein wichtiger Schritt hin zu vernetzten Quantenprozessoren.“
Qudora gehört zu den spannendsten Quantum-Startups aus Norddeutschland. Was macht den Norden für euch als Standort besonders attraktiv – und wie unterstützt euch das regionale Innovationsökosystem konkret?
„Norddeutschland bietet hervorragende Bedingungen: eine starke Forschungslandschaft, eine dynamische Startup-Szene und ein wachsendes Netzwerk aus innovationsfreudigen Industriepartnern. Besonders wertvoll ist für uns die Nähe zu Institutionen wie DESY, DLR oder der Universität Hamburg – hier entsteht nicht nur exzellente Grundlagenforschung, sondern auch anwendungsnahe Technologieentwicklung. Das regionale Innovationsökosystem unterstützt uns aktiv. So können wir unsere Quantencomputing-Systeme zügig entwickeln und perspektivisch auch kommerziell anbieten.“
„Große Potenziale sehen wir in der Pharma- und Chemieindustrie, der Materialforschung und in der Energiebranche – also überall dort, wo komplexe Systeme effizient simuliert oder Prozesse optimiert werden müssen.“
Dr. Amado Bautista
Wie nah seid ihr bei Qudora an konkreten Anwendungen – und in welchen Industriezweigen siehst du das größte Potenzial für Ionenfallen-basierte Quantencomputer in den nächsten Jahren?
„Wir stehen kurz davor, unsere Systeme über unsere eigene Cloud-Plattform oder gemeinsam mit ersten Partnern zugänglich zu machen. Die Kombination aus hoher Präzision, langer Kohärenzzeit und Zuverlässigkeit macht unseren QC-Systemen besonders attraktiv für Optimierungsprobleme, molekulare Simulationen und maschinelles Lernen. Große Potenziale sehen wir in der Pharma- und Chemieindustrie, der Materialforschung und in der Energiebranche – also überall dort, wo komplexe Systeme effizient simuliert oder Prozesse optimiert werden müssen.“
Welche Rolle spielen Forschungsinstitutionen wie die Universität Hamburg, DESY oder Fraunhofer für eure Entwicklung? Gibt es besondere Partnerschaften, die euch strategisch nach vorne bringen?
„Diese Institutionen sind für uns strategische Schlüsselpartner. Sie betreiben exzellente Forschung an der Schnittstelle von Physik, Informatik und Ingenieurwesen – genau dort, wo Quantencomputing technologisch verankert ist. Gleichzeitig fördern sie aktiv den Transfer in die Wirtschaft. Aktuell, gemeinsam mit unserem Partner NXP entwickeln wir im Rahmen der Quanten-Computing Initiative ein hochperformantes 50-Qubit-Quantencomputersystem – das derzeit leistungsstärkste in Deutschland.“
Wie trägt eure Ionenfallen-Technologie dazu bei, Hardware als echten Wettbewerbsvorteil zu etablieren?
„Quantencomputing ist eine hardwaregetriebene Disziplin – wer über bessere Qubits verfügt, kann Algorithmen effizienter, schneller und zuverlässiger ausführen. Unsere Systeme basieren auf hochpräziser, modularer und upgradefähiger Ionenfallen-Technologie. Sie erlaubt nicht nur präzise Rechenoperationen, sondern ist auch flexibel skalierbar. Wir entwickeln Hardware, die auf industrielle Anforderungen zugeschnitten ist und zugleich wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Das schafft einen klaren Differenzierungsvorteil, sowohl technologisch als auch wirtschaftlich.“
Die Integration von Quantencomputern in bestehende digitale Infrastrukturen ist eine große Herausforderung. Wie geht ihr diesen Übergang an – und wie reagieren potenzielle Industriepartner aus Norddeutschland darauf?
„Unser Ansatz ist es, Quantencomputing über Cloud-Plattformen und hybride Workflows nahtlos in bestehende IT-Systeme zu integrieren. Dafür entwickeln wir standardisierte Schnittstellen und arbeiten eng mit Hardware und Softwarepartnern regional und global zusammen.“
Wenn du einen Wunsch frei hättest, um das Quantum-Ökosystem noch stärker zu machen – in Bezug auf Politik, Talente oder Kapital – was würdest du dir wünschen?