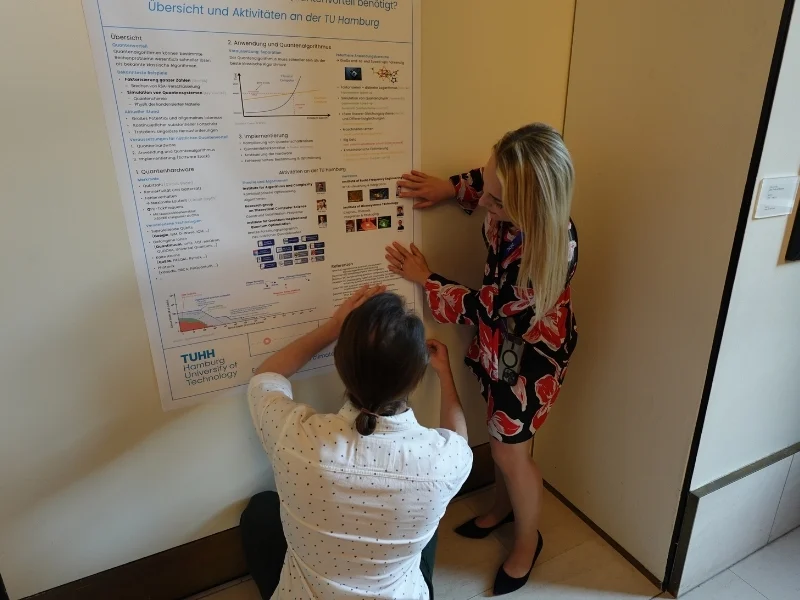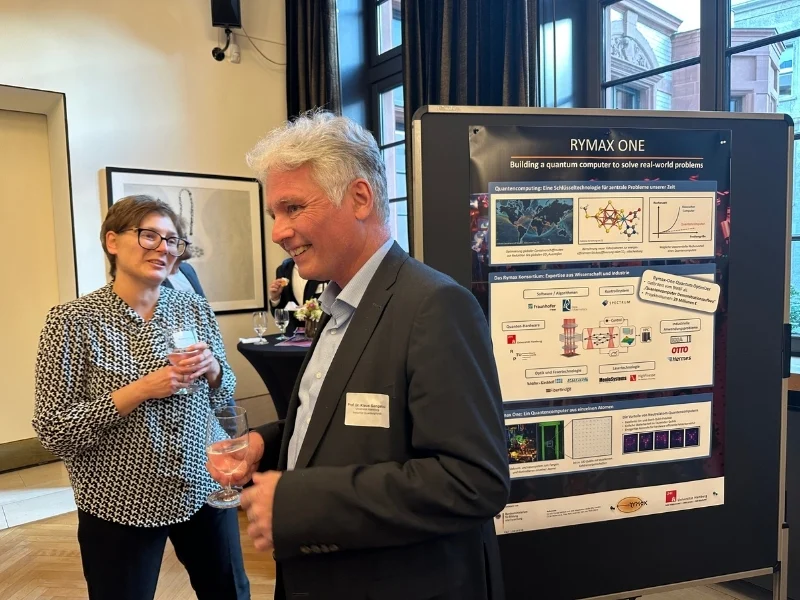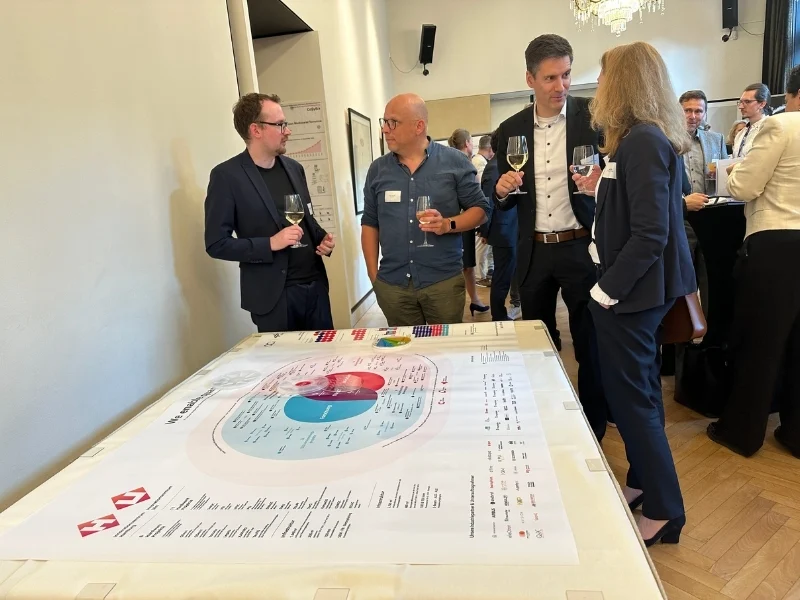Gemeinsam mit der Landesvertretung Hamburg in Berlin und der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation haben wir unseren allerersten Parlamentarischen Abend in Berlin ausgerichtet – gewidmet einer der transformativsten Technologien unserer Zeit: dem Quantencomputing.
Unser Ziel: den Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken – und Hamburg zu einer Region zu machen, in der Zusammenarbeit schnell, Entscheidungswege direkt und Innovation rasch in Anwendung überführt wird.
Inspirierende Keynotes – Perspektiven aus Wissenschaft & Industrie
Vier hochkarätige Redner:innen legten mit eindrucksvollen Impulsen den Grundstein für den Abend:
- Prof. Dr. Klaus Sengstock (Universität Hamburg) betonte die zentrale Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung und Industrie – nur durch diese Partnerschaft können echte Durchbrüche gelingen.
- Dr. Anisa Rizvanolli (Fraunhofer IQHH) zeigte, wie Quantencomputing bereits heute in realen Anwendungsszenarien getestet wird – ein Beweis dafür, dass die Zukunft längst begonnen hat.
- Dr. Christian Ertler (ParityQC) gab tiefe Einblicke in die Entwicklung spezialisierter Quantenarchitekturen, die effizientere und praxisnahe Lösungen ermöglichen sollen.
- Christian Wiebus (NXP Semiconductors) hob die unverzichtbare Rolle der Halbleitertechnologie bei der Industrialisierung des Quantencomputings hervor – insbesondere im Hinblick auf Standardisierung und Skalierbarkeit.
Paneldiskussion mit führenden Expert:innen
Im Anschluss an die Keynotes folgte eine spannende Paneldiskussion – souverän moderiert von Marina Tcharnetsky, Botschafterin des Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC) e.V. Die Diskutierenden teilten wertvolle Einsichten und Perspektiven aus ihren jeweiligen Fachbereichen:
- Prof. Dr. Kerstin Borras (DESY & RWTH Aachen) erläuterte die Rolle von PETRA IV und der Innovation Factory als Brücken zwischen Spitzenforschung und industrieller Anwendung.
- Dr. Robert Axmann (Leiter der DLR Quantencomputing-Initiative, QCI) forderte langfristige Strategien, Planungssicherheit und einen klaren technologischen Fokus für den Aufbau eines robusten Quanten-Ökosystems.
- Prof. Dr. Henning Moritz (Universität Hamburg) sprach sich dafür aus, die Grundlagenforschung als Fundament für Innovation, Talentbindung und langfristige Wirkung gezielt zu stärken.
- Dr. Lars Schwabe (CTO, Lufthansa Industry Solutions) plädierte für agile Testumgebungen, mutige Experimente und eine intensivere Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen.
- Alois Krtil (CEO, ARIC e.V.) betonte die Bedeutung klarer Kommunikation, langfristiger Finanzierung und einer gemeinsamen Haltung, um Hamburg als international sichtbaren Deep-Tech-Standort zu positionieren.
Zentrale Erkenntnisse – Was wir brauchen, um Quanten voranzubringen. Um das volle Potenzial quantentechnologischer Entwicklungen zu entfalten und wirkliche Anwendungseffekte zu erzielen, wurde an diesem Abend deutlich: Technologie allein reicht nicht – es braucht Strategie, Struktur und Haltung.
Viele der Punkte und Wünsche, die beim parlamentarischen Abend formuliert wurden, überschneiden sich deutlich mit dem aktuellen Entwurf der Europäischen Kommission, die jüngst ihren Plan für „Quantum made in Europe“ vorgestellt hat.
1. Funding
- Planbarkeit und stabile Förderstrukturen schaffen: Langfristige Ausschreibungen und klare Rahmenbedingungen sind essenziell, um Innovationsvorhaben strategisch und effizient planen zu können.
- Ganzheitlicher und vernetzter Förderansatz: Alle Akteure an einen Tisch bringen. Förderlogik muss systemisch gedacht werden – interdisziplinäre Zusammenarbeit ist der Schlüssel für wirksame Programme.
- Nachhaltigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit in den Fokus rücken: Förderinstrumente sollten wirtschaftliche Resilienz, Nachhaltigkeit und globale Anschlussfähigkeit gleichrangig adressieren.
- Weniger Bürokratie, schnellere Umsetzung: Schlanke Prozesse in der Förderung erleichtern besonders mittelständischen Unternehmen und Start-ups den Zugang zu Innovationsprogrammen.
- Ein Umfeld schaffen, das Freiräume für Neues bietet: Innovationen entstehen nicht linear. Risikofreudige, kreative Ansätze brauchen geschützte Räume und flexible Förderformate.
- Von strategischer Bedeutung: Schlüsseltechnologien, Lieferketten und Softwareentwicklung in DE/EU sichern. Um Abhängigkeiten zu verringern und Innovationssouveränität zu gewährleisten, müssen zentrale technologische Kompetenzen und industrielle Wertschöpfung langfristig in Deutschland und Europa gehalten und gezielt gestärkt werden.
2. Hardware
- Fokussierung auf ausgewählte Schlüsseltechnologien und nationale Stärken: Gezielte Investitionen in Felder wie Quantentechnologie, Neuromorphe Chips und photonische Systeme erhöhen die strategische Wirksamkeit öffentlicher Mittel.
- Vertrauen, Neugier und Geduld für Quantentechnologien: Die Entwicklung dieser Technologien ist langwierig und unsicher – sie braucht ein förderliches Innovationsklima und langfristiges Denken.
- Lab to Fab: Marktreife Lösungen mit wirtschaftlichem Spill-over ermöglichen. Schaffung von Produktionsstätten für Quantentechnologien, um die Produktion zu skalieren. Denn, Transferstrukturen vom Labor in die Industrie schaffen wirtschaftliche Verwertung und neue Geschäftsfelder – auch jenseits der Ursprungsdomäne.
- Industrienähe und Skalierung in den Mittelpunkt stellen: Skalierung ist essenziell für wirtschaftliche Wirkung – von der ersten Pilotfabrik bis hin zur Massenfertigung unter realen Marktbedingungen.
3. Software
- Sektorübergreifende Zusammenarbeit fördern: Deep-Tech-Software profitiert vom Zusammenspiel verschiedener Branchen, Disziplinen und Anwendungsbereiche – Kooperation beschleunigt Transfer.
- Proaktive Kommunikation und ein positives Narrativ für Deep Tech entwickeln: Die Innovationskraft Europas muss auch kommunikativ sichtbar gemacht werden – durch ein glaubwürdiges, ambitioniertes Narrativ.
- Chance der deutschen forschungsgetriebenen Industrie nutzen: Deutschland hat einen einzigartigen Vorteil: die Nähe zwischen angewandter Forschung und industrieller Praxis. Diese Stärke muss für konkrete Use Cases genutzt und international positioniert werden. Hierzu zählt das Ankerkundenprinzip, als auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und geschaffene physische Räume, die als Grundlage für Deep-Tech-Innovation dienen.
- Heuristiken sind unvermeidlich: Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Industrie fördern. Gerade bei disruptiven Software- und KI/Quantum-Innovationen sind heuristische Entwicklungsansätze essenziell – schnelles Ausprobieren, Lernen und Anpassung erfordern enge Industriekooperation.
- Strategische Perspektive: Softwareentwicklung langfristig in DE/EU verankern. Eigene Softwarekompetenz sichert technologische Unabhängigkeit. Kritische Anwendungen – von industrieller Steuerung bis zu sicherheitsrelevanter Infrastruktur – sollten in Europa entwickelt, kontrolliert und gepflegt werden.
4. Talent
- Vertrauen, Neugier und Geduld für Quantentechnologien kultivieren: Zukunftstechnologien erfordern nicht nur Kapital, sondern vor allem Menschen mit Mut zum Neuen, die bereit sind, über Jahre hinweg an Durchbrüchen zu arbeiten.
- Proaktive Deep-Tech-Kommunikation als Talentmagnet nutzen: Ein inspirierendes Narrativ hilft nicht nur der Außenwirkung, sondern zieht auch qualifizierte Fachkräfte und junge Talente an.
- Ein Umfeld schaffen, das Talente durch Freiraum und Sinnbindung motiviert: Innovationskultur entsteht dort, wo Kreativität, Risikobereitschaft und sinnstiftende Arbeit gefördert werden – das ist entscheidend im globalen Wettbewerb um Talente.
- Interdisziplinarität aktiv leben – als Quelle für kreative Lösungsansätze: Die besten Talente wollen heute nicht nur Fachdisziplinen vertiefen, sondern mitgestalten. Innovationsumgebungen müssen interdisziplinäre, praxisnahe Arbeit fördern.
Hamburg: Eine Modellregion für Quanten mit „Short Ways & High Impact“
Unsere gemeinsame Vision ist es, Hamburg zu einer Modellregion für Quanteninnovation zu machen – eine Region, in der Grundlagenforschung, industrielle Anwendung und Politik nahtlos miteinander verbunden sind. Denn Hamburg steht für: „Short Ways, High Impact“. Ein herzliches Dankeschön an alle politischen Vertreterinnen und Vertreter, die ihre Perspektiven eingebracht und den Dialog bereichert haben. Und ein besonderes Dankeschön an Dr. Heide Wedemeyer für ihre Gastfreundschaft in Berlin!